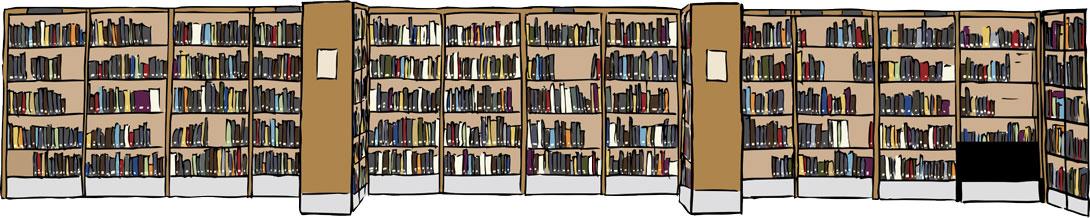Angorakaninchen sind eine besondere Rasse, deren Fell zu einer nachwachsenden Wolle mutiert ist. Aus den langen Kaninchenhaaren wird die Textilfaser Angora gewonnen. Als Angora wird ausschließlich die Faser vom Kaninchenhaar bezeichnet. Der Begriff findet keine Anwendung auf das Haar der Angoraziege. Wolle von der Angoraziege heißt Mohair.
Angora ist eine der feinsten Naturfasern. Die zarten, weichen Haare der Tiere werden drei- bis viermal jährlich geschoren oder ausgekämmt....
Auch wenn der Name etwas anderes vermuten lässt: Baumwolle wächst nicht auf Bäumen und ist auch keine Wolle.
Baumwollpflanzen zählen zur Familie der Malvengewächse. In den Früchten der Pflanzen befinden sich die langen Samenhaare, welche zur Fasergewinnung verwendet werden. Baumwolle kann von Natur aus weiß, braun oder grün sein. Farbig wachsende Baumwollarten erreichen ihre Endfarbe erst nach vielen Waschgängen. Um ihren endgültigen Farbton zu erreichen, müssen diese farbigen...
Der Flachsanbau und die Leinenweberei hat in Belgien eine lange Tradition. Flachs ist eine Faser, die natürlich und ursprünglich ist und deren Anbau ökologisch betrachtet viele Vorteile bietet.
Belgian Linen ist ein geschütztes Markenzeichen für Erzeugnisse von renommierten belgischen Unternehmen, die zum Teil auf eine mehr als 100jährige Firmengeschichte zurückblicken können. Diese Unternehmen haben sich strengen Kriterien verpflichtet. Sie produzieren nach hohen umweltschonenden und...
Um Hoflieferant des Belgischen Königshauses zu werden, muss ein Unternehmen oder eine Manufaktur höchsten Ansprüchen genügen können. Die regelmäßige und zuverlässige Belieferung mit Produkten bildet dabei nur einen Schwerpunkt. Mindestens genauso wichtig ist die Einhaltung strenger Qualitätsstandards. Nur wer dauerhaft eine qualitativ erstklassige Arbeit leistet und kontinuierlich anspruchsvolle Produkte und Dienstleistungen bieten kann, hat überhaupt die Chance, "Offizieller...
CLY ist Kurzzeichen für Lyocell. Lyocell ist eine aus Zellulose bestehende, einen industriell hergestellten Stoff, der aus natürlichen Rohstoffen gewonnen wird. Lesen Sie mehr unter Lyocell / Tencel.
CO2-Logic vergibt in Zusammenarbeit mit der akkreditierten belgischen Prüf- und Zertifizierungsorganisation Vinçotte nach strengen Vorgaben das Label "CO2-Neutral", das auf dem international anerkannten Standard PAS2060 basiert. Es wird an jene Unternehmen vergeben, die ihre Verantwortung für die Auswirkungen ihrer CO2-Emissionen ernst nehmen und sie nicht auf die Gesellschaft oder auf künftige Generationen abwälzen. Das Zertifikat garantiert, dass die entsprechenden Unternehmen oder...
Dinkel ist eine uralte Getreidesorte und zählt zu den sogenannten Spelzgetreiden. Das eigentliche Korn ist bei diesen Arten vom sogenannten Spelz, einer natürlicher Schutzhülle umgeben. Vor der weiteren Verarbeitung zu Mehl muss dieser Spelz in einer Schälmühle entfernt werden. Die dort anfallenden Dinkelspelzen sind viel zu schade, um in der Abfalltonne zu landen. Sie enthalten einen hohen Anteil Kieselsäure und werden von alters her zur Füllung von Kissen verwendet. Schon die...
Elasthan ist eine gummiartige, synthetische Chemiefaser, die sich durch hohe Dehnbarkeit, gepaart mit hoher Festigkeit, auszeichnet. Entwickelt wurde diese Kunstfaser vom amerikanischen Chemiekonzern DuPont, der sie 1959 unter ihrem ursprünglichen Namen "Fibre K" auf den Markt brachte.
Bekannte Markennamen sind Lycra und Dorlastan. Das Kürzel für Elasthan ist PUE (früher EL).
Hauptrohstoff für die Produktion von Elasthanfasern ist Erdöl.
Elasthan-Fäden können bis auf die...
Ökologisch, natürlich und gut gebettet auf einer Naturlatexmatratze - dafür bürgt das GOLS Siegel.
GOLS ist die Abkürzung für Global Organic Latex Standard.
Es handelt sich dabei um ein Zertifizierungsprogramm der Control Union Certifications, einer im Jahr 2002 gegründeten, international agierenden Stiftung. Control Union Certifications setzt sich für durchgehende Nachhaltigkeit innerhalb der Herstellungsketten im Nahrungs- und Futtermittelsektor, der Bioenergie- und der...
GOTS steht für die Begriffe Global Organic Textile Standard. Dieser Standard ist weltweit führend und anerkannt. GOTS definiert die umweltrelevanten und sozialen Anforderungen der gesamten Textilproduktionskette.
Die GOTS-Arbeitsgruppe besteht aus vier bekannten, internationalen Mitgliedsorganisationen, die zusammen mit weiteren internationalen Experten ihr Fachwissen beim Global Organic Textile Standard einbringen. Die Zertifizierung erfolgt industrieunabhängig. Zertifziert werden können...
Halbleinen ist ein geschützter Begriff für ein Mischgewebe aus Baumwolle und Leinen. Das übliche Mischungsverhältnis ist 50:50. Der dünne Längsfaden (Kettfaden) besteht aus reiner Baumwolle, der starke Querfaden (Schuss) besteht aus 100 % Leinen. Gemäß Textilkennzeichnungsgesetz muss ein als Halbleinen bezeichnetes Gewebe zu mindestens 40 % aus Leinen bestehen.
Halbleinen ist eine "Erfindung" des 19. Jahrhunderts. Bis dahin war die übliche Textilfaser Wolle, Hanf oder Leinen. Als die...
Hanf ist eine uralte Kulturpflanze, die bereits in der Antike für die Herstellung von Bekleidung Verwendung fand. Die Phönizier und viele Seefahrer nach ihnen, nutzten für die Herstellung von Segeln Hanftuch, da dessen Fasern gegenüber Salzwasser sehr widerstandsfähig sind und sich nur minimal mit Wasser vollsaugen.
Als Mitte des 19. Jahrhunderts der Schneider Levi Strauss die erste Jeans auf den Markt brachte, um die Goldwäscher in Kalifornien mit strapazierfähigen, nässeresistenten...
Hirse ist ein Spelzgetreide aus der Familie der Süßgräser. Hirse wurde schon im Altertum angepflanzt, große Anbaugebiete befinden sich heute in Ostasien und Afrika. Allerdings ist der Hirseanbau auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern wieder stark im Kommen, da die Gruppe der gesundheitsbewussten Verbraucher permanent wächst. Vor der Weiterverarbeitung werden die Hirsekörner vom Spelz, ihrer natürlichen Schutzhülle, befreit. Die Spelzen werden traditionell als...
Der IVN (Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft e.V.) ist ein Branchenverband, der sich aus mehr als 100 Unternehmen zusammensetzt, die sich ökologisch und sozial in der Verantwortung sehen. Die Mitglieder entstammen allen Bereichen der Leder- und Textilindustrie. Als internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft versteht sich diese Gruppierung als Sprachrohr und Förderer und hat zum Ziel, den Marktanteil von Produkten, die natürlich und nachhaltig sind zu steigern, indem...
Der natürliche Lebensraum des Kamels ist die Wüste, ein Ort mit extremen klimatischen Bedingungen. Tagsüber ist es bis zu 60 Grad heiß und nachts sehr kalt, mit Temperaturen um den Nullpunkt. Sein Haar dient dem Kamel als Klimaanlage, es schützt das Tier vor der extremen Hitze und wärmt es in den kalten Nächten. Kamelhaar ist von rötlich-brauner Farbe und 3-12 cm lang. Das Deckhaar (Granne) der Tiere ist grob, das Unterhaar jedoch flaumig, fein und gekräuselt. In der Textilindustrie...
Wird die Rinde des Gummi- bzw. Kautschukbaums angeschnitten, tritt ein weißer Milchsaft aus. Dieser Milchsaft ist das sogenannte Latex, welches in getrockneter Form als Kautschuk bekannt ist und unter anderem zur Herstellung von Gummi verwendet wird. Man unterscheidet Natur- und Syntheselatex. Naturlatex ist weitgehend geruchsneutral, während dem Syntheselatex (aus Rohöl) zunächst ein etwas gewöhnungsbedürftiger Geruch anhaftet.
Latexkleidung wird in aufwändigen Verfahren hergestellt,...
Leinen ist ein Gewebe aus Naturfasern, welche aus den Stängeln der Lein-/Flachspflanze gewonnen wird. Die leuchtend blau blühende Pflanze ist als 'Gemeiner Lein' bekannt und dient neben der Fasergewinnung auch zur Herstellung von Leinsamen und Öl.
Leinengewebe wurden bereits in der Antike als Kleidung und Verbandmaterial verwendet. Ägyptische Mumien wurden mit Leinen umwickelt und die griechischen Kämpfer fertigten aus Flachfasern Leinenpanzer. In der Neuzeit wurde Leinen von Baumwolle...
Lyocell wird aus Zellulose hergestellt und zählt wie die eng verwandte Viskose zu den sogenannten Zellulose-Regeneratfasern. Im Gegensatz zu anderen Zellulosefasern wie z.B. Viskose ist der Herstellungsprozess von Lyocell deutlich weniger belastend für die Umwelt. Umweltschonende Lösungsmittel und ein geschlossener Stoffkreislauf bei der Lyocellherstellung machen dies möglich. Im Vergleich zum Baumwollanbau ist der Ertrag pro Quadratmeter Anbaufläche bei Lyocell etwa 6 mal höher. Die EU...
Leinen ist ein Gewebe, das natürlich, nachhaltig und ökologisch wertvoll ist. Der Rohstoff für dieses hochwertige, natürlich glänzende Produkt ist Flachs, eine Pflanze deren Anbau und Verarbeitung sehr arbeitsintensiv ist und dedizierte Kenntnisse voraussetzt.
Masters of Linen ist ein geschütztes Warenzeichen und eine Qualitätsauszeichnung für Leinen, das zu 100 Prozent, von der Ernte über die Faser bis hin zum fertigen Gewebe in Europa hergestellt wurde. Die Schutzmarke Masters of...
Das Merinoschaf ist eine ursprünglich aus Nordafrika stammende Schafrasse, die eine besonders begehrte Feinwollsorte liefert: die Merinowolle. Nach Europa kamen die ersten Merinoschafe im Hochmittelalter, ab dem 19. Jahrhundert gab es auch in anderen europäischen Ländern große Herden. Die Tiere werden bis auf die Haut geschoren, ein "Spitzentier" kann bis zu zehn Kilogramm Merinowolle liefern, das ist in etwa dreimal mehr als bei einem gewöhnlichen Schaf. Merinoschafe haben im Vergleich zu...
Polyamid ist eine Kunstfaser, deren Siegeszug nach dem Zweiten Weltkrieg begann, als die ersten Damenfeinstrumpfhosen auf den Markt kamen. Bis heute sind die Bezeichnungen 'Nylons' oder 'Perlonstrümpfe' den meisten Menschen als Synonym für Feinstrumpfhosen ein Begriff. Nylon, Perlon und Dederon sind Markennamen für Polyamidfasern von jeweils unterschiedlichen Herstellern.
Polyamid ist eine sehr leichte Faser, die sich zu extrem dünnem Garn verspinnen lässt. Trotz ihrer Zartheit ist...
Polyester ist eine synthetische Chemiefaser auf der Basis von Erdöl, Terephtalsäure und Äthylenglykol. Bekannte Markennamen sind Trevira, Dacron und Diolen. Im Vergleich zu einer Naturfaser ist die Struktur von Polyester sehr gleichmäßig. Wird die Faser zu einem texturierten Garn verarbeitet, verleiht die Textur dem Gewebe wärmende Eigenschaften. Die glatte Faser wirkt eher kühlend. Unter Textur versteht man einen Vorgang, der einer glatten Faser eine Kräuselung beibringt, so dass diese...
Qualitäts- oder Gütesiegel, bzw. Gütezeichen gibt es in Deutschland fast wie Sand am Meer. Es gibt keine gesetzlichen Regelungen und im Prinzip kann jeder ein solches Siegel kreieren. Für den Endverbraucher ist es damit so gut wie unmöglich, die einzelnen Gütesiegel ohne entsprechende Beratung zu bewerten. Mit unserem Textillexikon möchten wir Sie bei der Bewertung und Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen.
Im Gegensatz zum Prüfsiegel, das sich hauptsächlich sicherheitsrelevanter...
Der Qualitätsverband umweltverträgliche Latexmatratzen e.V. wurde im Jahr 1994 gegründet. Entstanden ist der Verband aus einer Expertenkommission aller an der Produktion und Verarbeitung von Naturlatex beteiligten Gruppen. Der QUL ist international anerkannt und kontrolliert die Standards von Naturmatratzen. Das vom Verband verliehene QUL-Prüfsiegel bürgt für eine größtmögliche gesundheitliche Sicherheit und eine ökologisch verträgliche Produktion.
Der QUL entwickelte als Pionier...
Rossschweifhaare werden aus den Schweifen von Pferden ausgekämmt oder abgeschnitten. Es handelt sich um ein sehr strapazierfähiges und elastisches Haar mit hoher Sprungkraft, das beispielsweise als Einlagenstoff oder zur Füllung von Matratzen und Kissen verwendet wird. Rossschweifhaare in Kissen, Polstern und Matratzen sind sehr robust und haben eine lange Lebensdauer. Nach der Wäsche und Desinfektion der Rosshaare werden diese zu einem Zopf oder einer Spirale zusammengedreht. Auf diese...
Schafwolle ist ein Begriff, der in der Regel ausschließlich für Wolle vom Hausschaf verwendet wird. Archäologische Funde weisen die Verarbeitung von Schafwolle bereits für die Jungsteinzeit nach. Einmal pro Jahr, meistens im April oder Mai, werden die Schafe geschoren. Die Arbeit wird von speziell ausgebildeten Schafscherern ausgeführt, denn sie erfordert viel Geschick und Schnelligkeit. Durchschnittlich benötigt ein Scherer für das komplette Tier nur zwei bis drei Minuten. Die...
Seide ist sowohl eine Naturfaser als auch ein Filament (= Endlosfaser). Mit Filament bezeichnet die Textilindustrie Fasern mit mindestens 1000 Meter Länge. Zu diesen Endlosfasern zählen Chemiefasern und Naturseide. Seide unterscheidet sich damit grundsätzlich von anderen Naturfasern, denn sie wird nicht mittels eines Spinnvorgangs gewonnen. Seide ist das Produkt eines Schmetterlings, genauer gesagt eines Nachtfalters. Es gibt viele Arten von Schmetterlingen, deren Puppen sich in einem Kokon...
Torf - eine wiederentdeckte Naturfaser
Torf wurde bereits vor Jahrhunderten als wärmende Schlafunterlage (sogenanntes Torfbett) verwendet. In jüngster Zeit erlebt dieses Naturmaterial eine Renaissance. Torffasern bestehen hauptsächlich aus Überresten von in Moorerde mumifiziertem Wollscheidegras. Biologische Abbauprozesse unter Luftabschluss haben die Pflanzen im Lauf der Jahrhunderte zu Torf umgewandelt. Die Torffasern werden aus den Tiefen der Moore entnommen, wo sie von...
Viskose ist eine synthetische Faser, deren Ausgangsstoff natürliche Zellulose ist. Der nachwachsende Rohstoff Zellulose stammt von Holz verschiedener Baumarten. "Echte" Synthetikfasern werden aus Mineralöl hergestellt. Für die Verarbeitung ist der Einsatz von Natronlauge, Schwefelkohlenstoff und anderen Chemikalien notwendig. Es wird zunächst eine Art Zellulosebrei hergestellt, aus dem in vielen weiteren Verarbeitungsschritten die Fasern gewonnen werden. Trotz dieser aufwändigen Prozesse,...
Was ist Wildseide?
Im Gegensatz zu der Seide von gezüchteten Maulbeerspinnern wird Wildseide von Schmetterlingsarten gewonnen, die sich nicht zur Zucht eignen. Bei diesen handelt es sich unter anderem um die Tussahspinner und den Eichenseidenspinner.
Bei diesen Arten wird der Kokon erst dann zur Seidengewinnung verwendet, wenn die Schmetterlingsraupen bereits geschlüpft sind. Hierdurch wird den Tieren also kein Schaden zugefügt. Allerdings wird durch das Durchbohren des Kokons die...
Das Textilkennzeichnungsgesetz regelt die Deklaration von Fasern für die Textilherstellung. Als Wolle werden gemäß Gesetz die weichen Fellhaare, vor allem des Schafes bezeichnet. Spinnfähige Haare anderer Tiere dürfen als Wolle bezeichnet werden, sind aber mit einem näher bezeichnenden Vorsatz versehen, z.B. Angorawolle. Die Ursprünge der Wollnutzung liegen in Vorderasien, im 4. Jahrtausend vor Christus.
Im Vergleich zu Baumwolle oder Seide ist die Wollfaser gröber strukturiert. Ihre...
Zellulose ist ein wichtiger Rohstoff, der den meisten Menschen als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Papier und Hygieneprodukten wie Papiertaschentücher, Cellophan, Tissues, Tampons, etc. bekannt ist.
Holz von Laub- oder Nadelbäumen ist reich an Lignin und Zellulose. Cellulose stellt mit etwa 50 % Anteil an der Gesamtmasse den Hauptbestandteil von pflanzlichen Zellwänden dar und verleiht ihnen die notwendige Stabilität. Entdeckt wurde die Zellulose Mitte des 19. Jahrhunderts von...
Das Wort ist aus den lateinischen Vokabeln "certus" (sicher) und "facere" (machen) gebildet. Bei einem Zertifikat handelt es sich daher um eine Beglaubigung. Es wird versichert und bescheinigt, dass bestimmte Merkmale auf einen Gegenstand zutreffen.
Bei den Textilien gibt es jede Menge Zertifikate, nicht alle sind aussagefähig. Nicht alle sind neutral erstellt und global anerkannt.
Damit Sie sich gut zurecht finden, gibt es unser Lexikon mit ausführlichen Erläuterungen, was es mit den...
Textilien sollen idealerweise weitgehend natürlich und ökologisch verantwortungsbewusst hergestellt sein.
Öko-Tex Standard 100 ist eines von mehreren Produktsiegeln, das von der internationalen Gemeinschaft für Forschung und Prüfung auf dem Gebiet der Textil- und Lederökologie vergeben wird. Die Gemeinschaft setzt sich aus 18 unabhängigen Textilforschungs- und Prüfungsinstituten aus Europa und Japan zusammen und agiert weltweit mit eigenen Kontaktbüros. Öko-Tex Standard 100 wurde im...